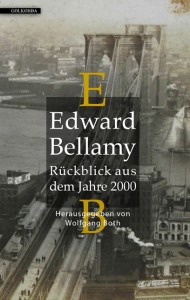George Orwell und die Zerstörung einer anarchistischen Utopie
von Dirk Jürgensen ...
Wir brauchen Utopien – Teil 5
– Wer sich mit utopischen Zukunftsmodellen beschäftigt, kommt am Anarchismus vorbei und sollte unbedingt nach Spanien blicken.
Als Thomas Morus im Jahr 1516 sein „Utopia“ schrieb, waren die Begriffe Sozialismus und Kommunismus noch in keinem Wortschatz zu finden. Im 16. Jahrhundert mit seinen aus dem Elend erwachsenen Bauernaufständen und den Ideen eines entstehenden Humanismus, der sich an den Bürger-(Polis-) Gedanken und anderen frühen demokratischen Vorstellungen orientierte, war „Utopia“ ein Gegenentwurf zum Feudalismus. Gemeinsames Arbeiten an und mit gemeinsamen Produktionsmitteln in allgemeiner Freiheit, kein Ausufern privaten Eigentums, das waren revolutionäre Vorstellungen und sind bis heute ein nicht realisiertes Sinnbild einer idealen und gerechten Gesellschaftsordnung – ein Wunschbild, eben eine Utopie – geblieben.
Das 17. und 18. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung in Verbund mit dem Fortschreiten der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung, das Entstehen industrieller Massenproduktion und die Anfänge der Globalisierung, veränderte die Lebensumstände der Menschen enorm. Der Feudalismus wurde von einer neuen Klassengesellschaft abgelöst. Der neue Adel bestand aus den wenigen Industriekapitänen jener Zeit. Und wenn auch der Humanismus als Teil aufklärerischen Gedankenguts verstanden werden kann, war angesichts der Kategorisierung des Menschen als Produktionsfaktor Arbeit – wir würden heute vielleicht Humankapital sagen – und den damaligen Zuständen zwischen Verarmung der Landbevölkerung und der Kinderarbeit in den wachsenden Städten nichts zu spüren. Einzelne Revolten, frühsozialistische Versuche, wie beispielsweise die eines Robert Owen, konnten dem herrschenden rücksichtslosen Kapitalismus in seiner Gesamtheit nichts anhaben und zeigten, wie weit das Ziel einer gerechten Gesellschaft von der gelebten Realität der Unterschicht entfernt war.
So fand Karl Marx für die Bestrebungen der Frühsozialisten nach Demokratie und Gleichheit den Begriff des „utopischen Sozialismus“, in dem zwar ein lobenswertes Ziel, nicht jedoch der Weg dahin bestimmt wurde. Marx lehnte es sogar ab, das Ziel zu definieren und den Menschen das unwissenschaftliche Bild einer Idealgesellschaft zu erfinden. Er beschränkte sich bewusst darauf, historisch-systematisch die notwendigen Handlungsschritte zu entwickeln, um die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen über den Kampf der Klassen zu verbessern.
Der Gedanke liegt nahe, dass die seit Marx betriebene negative Besetzung des Utopiebegriffs letzthin dafür gesorgt hat, das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. Somit bewirkte dieses Bilderverbot zwangsläufig das Umschlagen sozialistischer und kommunistischer Revolutionen hin zum zentralistischen Totalitarismus einer Einheitspartei oder eines Komitees, der auf dem ziellosen Weg in eine undefinierten Idealgesellschaft jedes Vergehen als Mittel zum Zweck des Machterhalts rechtfertigte.
Einen anderen, einen keineswegs zentralistischen Weg schlugen zum Ziel einer gerechten Gesellschaftsordnung schlugen die Anarchisten ein, deren früher Hauptvertreter Pierre-Joseph Proudhon war. Er gilt als Begründer des Syndikalismus, Mutualismus und Förderalismus. Proudhons gerne zitierter Satz aus dem Jahr 1840 „Eigentum ist Diebstahl!“ sollte übrigens relativiert betrachtet werden, denn lehnte nicht das Privateigentum an sich ab, sondern er forderte die Abschaffung des Privatbesitzes an Produktionsmitteln.
In der Folge Proudhons hielten Michail Bakunin und Pjotr Alexejewitsch Kropotkin ähnlich wie Marx und Engels eine soziale Revolution für erforderlich, um die Besitzverhältnisse entscheidend verändern zu können. Im Gegensatz zu den Marxisten wurde die Führung durch eine elitäre Kaderpartei wie auch eine staatliche Hierarchie abgelehnt. Marx sah den Staat mit der fortschreitenden Revolution absterben, die Anarchisten trauten dieser undeutlichen Entwicklung nicht, sie wollten ihn direkt abschaffen, verfolgten einen antiautoritären Sozialismus.
Von 1864 bis 1872 kamen die Vertreter verschiedenster Gruppierungen, die sich zur Arbeiterbewegung zählten, in der IAA (Internationale Arbeiterassoziation) zusammen. Nachdem Karl Marx aufgrund unüberbrückbarer Unterschiede zwischen den Lagern erfolgreich dafür gesorgt hatte, dass Bakunin 1872 ausgeschlossen wurde, zerbrach die Erste Internationale, die dann 1876 vollständig aufgelöst wurde.
Dies war der Beginn eines bis in die heutige Zeit währenden Konflikts zwischen den Marxisten und den Anarchisten, eines Konflikts in dem es viel um Meinungshoheiten und um Macht, in dem die Marxisten fast immer die Oberhand gewannen. Obgleich eigentlich beide Gruppierungen ein nahezu gleiches Ziel verfolgen, kam es in der Geschichte immer wieder zu

Die Zeitung der Escuela Moderna, einem anarchistischen Bildungsprojekt von Francisco Ferrer – Quelle: Wikipedia
Ein Land, in dem der Marxismus im Gegensatz zum Anarchismus verhältnismäßig wenig Fuß fassen konnte, ist Spanien. Besonders das industriell geprägte Katalonien und das landwirtschaftlich dominierte Andalusien sind hier zu nennen. Selbst der Spanische Bürgerkrieg, aus dem das faschistische Franco-Regime als Sieger hervorging, konnte nicht verhindern, dass es in Spanien noch heute zahlreiche Beispiele anarchistisch geprägter kommunaler Kooperationen gibt.
Auch der Verlauf des Bürgerkriegs selbst, an dem zuerst Marxisten und Anarchisten auf Seiten der Republikaner gegen den Faschismus kämpften, war vom eben beschriebenen Konflikt geprägt – vielleicht sogar entscheidend. George Orwell, der in seinem Bericht „Mein Katalonien“ als Mitkämpfer im Spanischen Bürgerkrieg berichtet, lässt das mit seinen Beobachtungen und dem entstandenen Nebenkriegsschauplatz vermuten:
„Der allgemeine Umschwung nach rechts begann ungefähr im Oktober und November 1936, als die UdSSR anfing, die Zentralregierung mit Waffen zu versorgen, und als die Macht von den Anarchisten auf die Kommunisten überging. Außer Russland und Mexiko besaß kein anderes Land den Anstand, der Zentralregierung zu Hilfe zu kommen, und Mexiko konnte aus einleuchtenden Gründen Waffen nicht in großen Mengen liefern. So waren also die Russen in der Lage, die Bedingungen zu diktieren. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass diese Bedingungen vor allem lauteten: »Verhindert die Revolution, oder ihr bekommt keine Waffen.« So wurde die erste Maßnahme gegen die revolutionären Elemente, nämlich die Verdrängung der P.O.U.M. aus der katalanischen Generalidad, nach Befehlen der UdSSR durchgeführt. Man hat abgeleugnet, dass die russische Regierung irgendeinen direkten Druck ausgeübt habe. Aber diese Tatsache ist nicht von großer Bedeutung, denn man kann annehmen, dass die kommunistischen Parteien aller Länder die russische Politik ausführen. Es wird aber nicht geleugnet, dass die kommunistische Partei die hauptsächliche Triebkraft zunächst gegen die P.O.U.M., später gegen die Anarchisten, den von Caballero geführten Flügel der Sozialisten und allgemein gegen eine revolutionäre Politik war. Nachdem sich die UdSSR einmal eingemischt hatte, war der Triumph der kommunistischen Partei gesichert.
Zunächst wurde das kommunistische Prestige dadurch enorm gehoben, dass man Russland gegenüber dankbar war für die Waffen und die Tatsache, dass die kommunistische Partei besonders nach Ankunft der Internationalen Brigade den Anschein erweckte, als könnte sie den Krieg gewinnen.
Zweitens wurden die russischen Waffen durch die kommunistische Partei oder die mit ihr verbündeten Parteien ausgeliefert, und sie achteten darauf, dass ihre politischen Gegner sowenig wie möglich davon erhielten (Anm.: Das war der Grund dafür, dass es an der aragonischen Front so wenig russische Waffen gab, da die Truppen dort hauptsächlich Anarchisten waren. Bis zum April 1937 sah ich als einzige russische Waffe – mit Ausnahme einiger Flugzeuge, die vielleicht russisch waren, vielleicht aber auch nicht – nur eine einzelne Maschinenpistole.).
Drittens gelang es den Kommunisten durch die Verkündung einer nichtrevolutionären Politik, alle diejenigen um sich zu scharen, die von Extremisten verscheucht worden waren. Es war beispielsweise leicht, die wohlhabenderen Bauern gegen die Kollektivierungspolitik der Anarchisten zu sammeln. Die Mitgliedschaft der Partei wuchs gewaltig an, der Zufluss speiste sich hauptsächlich aus dem Mittelstand: Ladenbesitzer, Beamte, Armeeoffiziere, wohlhabende Bauern und so weiter, und so weiter.
Im Grunde genommen war der Krieg ein Dreieckskampf. Das Ringen mit Franco musste fortgesetzt werden, aber gleichzeitig war es das Ziel der Zentralregierung, alle Macht zurückzugewinnen, die noch in den Händen der Gewerkschaften verblieben war. Dies geschah durch eine Reihe kleiner Manöver, es war eine Politik der Nadelstiche, wie es jemand genannt hat, und man tat es, im ganzen gesehen, sehr klug. Es gab keine allgemeine, offene Gegenrevolution, und bis zum Mai 1937 war es nicht einmal nötig, Gewalt anzuwenden. Man konnte die Arbeiter immer durch ein Argument zur Räson bringen, das fast zu augenfällig ist, um es zu nennen: »Wenn ihr dieses oder jenes nicht tut, werden wir den Krieg verlieren.« In jedem Fall natürlich verlangte anscheinend die militärische Notwendigkeit, etwas aufzugeben, das die Arbeiter 1936 für sich errungen hatten. Aber dieses Argument war immer stichhaltig, denn das letzte, was die Revolutionsparteien wünschten, war, den Krieg zu verlieren. Verlor man den Krieg, würden Demokratie und Revolution, Sozialismus und Anarchismus zu bedeutungslosen Worten. Die Anarchisten, die einzige Revolutionspartei, deren Größe von Bedeutung war, wurden gezwungen, Stück für Stück nachzugeben. Das Fortschreiten der Kollektivierung wurde angehalten, die örtlichen Ausschüsse wurden entfernt, die Arbeiterpatrouillen wurden aufgelöst, die Polizeikräfte der Vorkriegszeit wurden, weitgehend verstärkt und schwer bewaffnet, wieder eingesetzt, und verschiedene Schlüsselindustrien, die unter der Kontrolle der Gewerkschaften gestanden hatten, wurden von der Regierung übernommen. (Die Übernahme des Telefonamtes von Barcelona, die zu den Maikämpfen geführt hatte, war ein Beispiel dieser Entwicklung.)
Schließlich, und das war das allerwichtigste, wurden die Milizeinheiten der Arbeiter, die sich auf die Gewerkschaften gründeten, allmählich auseinandergebrochen und in die neue Volksarmee aufgeteilt. Das war eine ‚unpolitische‘ Armee, sie hatte einen halben Bourgeoischarakter. Es gab unterschiedlichen Sold, eine privilegierte Offizierskaste und so weiter, und so weiter. Unter den besonderen Umständen war das tatsächlich ein entscheidender Schritt. In Katalonien vollzog man ihn allerdings später als an anderen Orten, denn hier waren die Revolutionsparteien am stärksten. Offensichtlich bestand die einzige Garantie für die Arbeiter, ihre Errungenschaften zu festigen, nur darin, einen Teil ihrer Streitkräfte unter ihrer eigenen Kontrolle zu haben. Wie gewöhnlich wurde auch das Auseinanderbrechen der Miliz im Namen militärischer Leistungsfähigkeit vollzogen, und niemand leugnete, dass eine gründliche militärische Reorganisation notwendig war. Es wäre aber durchaus möglich gewesen, die Miliz zu reorganisieren und leistungsfähiger zu machen und sie gleichzeitig unter der direkten Kontrolle der Gewerkschaften zu belassen. Der Hauptzweck des Wechsels lag darin, dafür zu sorgen, dass die Anarchisten keine eigenen Waffen mehr besaßen. Außerdem war der demokratische Geist der Miliz ein Brutnest für revolutionäre Ideen. Die Kommunisten wussten das sehr genau und schimpften ohne Unterlass und erbittert über die P.O.U.M. und das anarchistische Prinzip des gleichen Lohns für alle Ränge. Es fand eine allgemeine ‚Verbürgerlichung‘ statt, eine absichtliche Zerstörung des Gleichheitsgeistes aus den ersten Monaten der Revolution. Alles ereignete sich so geschwind, dass Leute, die Spanien innerhalb von wenigen Monaten mehrmals besucht hatten, erklärten, dass sie anscheinend kaum das gleiche Land besuchten. Was an der Oberfläche und für eine kurze Weile ein Arbeiterstaat zu sein schien, verwandelte sich vor den eigenen Augen in eine herkömmliche Bourgeoisrepublik mit der normalen Unterscheidung von reich und arm. Im Herbst 1937 erklärte der ‚Sozialist‘ Negrin in öffentlichen Ansprachen, dass »wir privates Eigentum respektieren«, und Mitglieder des Cortes, die zu Beginn des Krieges aus dem Land fliehen mussten, da man sie faschistischer Sympathien verdächtigte, kehrten nach Spanien zurück.“
Dass die beschriebene Einflussnahme der UdSSR im absoluten Widerspruch zur in Teilen Spaniens gelebten Utopie Spaniens stand, wird durch dieses Zitat Orwells deutlich:
„Die Arbeitermiliz, die auf den Gewerkschaften aufbaute und sich aus Leuten von ungefähr der gleichen politischen Meinung zusammensetzte, bewirkte, dass an einer Stelle die intensivsten revolutionären Gefühle des ganzen Landes zusammenkamen.
Ich war mehr oder weniger durch Zufall in die einzige Gemeinschaft von nennenswerter Größe in Westeuropa gekommen, wo politisches Bewusstsein und Zweifel am Kapitalismus normaler waren als das Gegenteil. Hier in Aragonien lebte man unter Zehntausenden von Menschen, die hauptsächlich, wenn auch nicht vollständig, aus der Arbeiterklasse stammten. Sie lebten alle auf dem gleichen Niveau unter den Bedingungen der Gleichheit. Theoretisch herrschte vollkommene Gleichheit, und selbst in der Praxis war man nicht weit davon entfernt. In gewisser Weise ließe sich wahrhaftig sagen, dass man hier einen Vorgeschmack des Sozialismus erlebte. Damit meine ich, dass die geistige Atmosphäre des Sozialismus vorherrschte. Viele normale Motive des zivilisierten Lebens – Snobismus, Geldschinderei, Furcht vor dem Boss und so weiter – hatten einfach aufgehört zu existieren. Die normale Klasseneinteilung der Gesellschaft war in einem Umfang verschwunden, wie man es sich in der geldgeschwängerten Luft Englands fast nicht vorstellen kann. Niemand lebte dort außer den Bauern und uns selbst, und niemand hatte einen Herrn über sich.
Natürlich konnte dieser Zustand nicht andauern. Es war einfach ein zeitlich und örtlich begrenzter Abschnitt in einem gewaltigen Spiel, das augenblicklich auf der ganzen Erdoberfläche gespielt wird. Aber es dauerte lange genug, um jeden, der es erlebte, zu beeindrucken. Wie sehr damals auch geflucht wurde, später erkannte jeder, dass er mit etwas Fremdem und Wertvollem in Berührung gewesen war.
Man hatte in einer Gemeinschaft gelebt, in der die Hoffnung normaler war als die Gleichgültigkeit oder der Zynismus, wo das Wort Kamerad für Kameradschaft stand und nicht, wie in den meisten Ländern, für Schwindel. Man hatte die Luft der Gleichheit eingeatmet. Ich weiß sehr genau, wie es heute zum guten Ton gehört zu verleugnen, dass der Sozialismus etwas mit Gleichheit zu tun hat.
In jedem Land der Welt ist ein ungeheurer Schwarm Parteibonzen und schlauer, kleiner Professoren beschäftigt zu ‚beweisen‘, dass Sozialismus nichts anderes bedeutet als planwirtschaftlichen Staatskapitalismus, in dem das Motiv des Raffens erhalten bleibt. Aber zum Glück gibt es daneben auch eine Vision des Sozialismus, die sich hiervon gewaltig unterscheidet.
Die Idee der Gleichheit zieht den normalen Menschen zum Sozialismus hin. Diese ‚Mystik‘ des Sozialismus lässt ihn sogar seine Haut dafür riskieren.
Für die große Mehrheit der Menschen bedeutet der Sozialismus die klassenlose Gesellschaft, oder er bedeutet ihnen überhaupt nichts. Unter diesem Gesichtspunkt aber waren die wenigen Monate in der Miliz wertvoll für mich. Denn solange die spanischen Milizen sich hielten, waren sie gewissermaßen der Mikrokosmos einer klassenlosen Gesellschaft. In dieser Gemeinschaft, in der keiner hinter dem Geld herrannte, wo alles knapp war, es aber keine Privilegien und kein Speichellecken mehr gab, fand man vielleicht in groben Umrissen eine Vorschau davon, wie die ersten Schritte des Sozialismus aussehen könnten. Statt mir meine Illusionen zu rauben, fesselte mich dieser Zustand. Die Folge war, dass ich noch viel stärker als vorher wünschte, der Sozialismus möge verwirklicht werden. Teilweise kam das daher, weil ich das Glück gehabt hatte, unter Spaniern zu leben. Mit ihrer angeborenen Anständigkeit und ihrem immer gegenwärtigen anarchistischen Gefühl würden sie selbst die ersten Stadien des Sozialismus erträglicher machen, wenn man ihnen nur eine Chance gäbe.“ Wieviel anders wird Orwell in seiner Dystopie „1984“ ein totalitäris Sytem beschreiben.
Als Orwell seinen Bericht verfasste, war der Spanische Bürgerkrieg noch im vollen Gange. Die gelebte Utopie, deren Ende auch Hans Magnus Enzensberger in seinem dokumentarischen Roman „Der kurze Sommer der Anarchie“ über Buenaventura Durruti beschrieb, wurde zum Teil einer gemeinsamen Erinnerung der Beteiligten. Es scheint, dass die aktuellen Krisen dieser Welt eine Rückbesinnung auf die Utopie als Zukunftsziel notwendig machen.
Meine Lesetipps zum Thema:
George Orwell – Mein Katalonien
Hans Magnus Ezensberger – Der kurze Sommer der Anarchie
Buch und Film von Isamelle Fremeaux und John Jordan – Pfade durch Utopia
Achim von Borries/Ingeborg Weber-Brandies (HG.) – Anarchismus Theorie Kritik Utopie
Der Film „Die Utopie leben! Der Anarchismus in Spanien„, den der Sender arte vor einigen Jahren ausstrahlte, sollte unbedingt auf DVD erscheinen oder wenigstens wiederholt werden!
Selbstverständlich sind die Amazon-Links nur im Notfall zu verwenden. Viel ratsamer ist die Unterstützung des lokalen Buchhandels.
Die Reihe wird fortgesetzt.







 – Ältere mögen sich erinnern. An jene Errungenschaft der modernen Welt, für einen Artikel nicht mehr von Geschäft zu Geschäft laufen zu müssen, weil es doch in jeder größeren Stadt mindestens einen Kaufhof, Wertheim, Horten, Hertie oder Karstadt gab. Eines dieser Warenhäuser genügte, um sich vollständig einzukleiden und ganz nebenbei auch noch Lebensmittel, Kosmetik, Uhren und Schmuck oder Haushaltartikel in riesigen Tüten nach Hause zu schleppen. Kleine Geschäfte mögen geflucht haben, aber als Kunde liebte man, endlich „tausendfach, alles unter einem Dach“.
– Ältere mögen sich erinnern. An jene Errungenschaft der modernen Welt, für einen Artikel nicht mehr von Geschäft zu Geschäft laufen zu müssen, weil es doch in jeder größeren Stadt mindestens einen Kaufhof, Wertheim, Horten, Hertie oder Karstadt gab. Eines dieser Warenhäuser genügte, um sich vollständig einzukleiden und ganz nebenbei auch noch Lebensmittel, Kosmetik, Uhren und Schmuck oder Haushaltartikel in riesigen Tüten nach Hause zu schleppen. Kleine Geschäfte mögen geflucht haben, aber als Kunde liebte man, endlich „tausendfach, alles unter einem Dach“.


 Brasilien, meistgenannter Favorit, ist ohne große spielerische Begeisterung noch im Rennen. Aber wann haben die zuletzt eigentlich so richtig begeistert und ihre Legende von der landestypischen Spielkunst gefestigt? Pelé, Rivelino und Zico und spielen schon länger nicht mehr und es steht zu befürchten, dass es im Laufe des Turniers einer Mannschaft gelingt, Neymar sicher zu bewachen.
Brasilien, meistgenannter Favorit, ist ohne große spielerische Begeisterung noch im Rennen. Aber wann haben die zuletzt eigentlich so richtig begeistert und ihre Legende von der landestypischen Spielkunst gefestigt? Pelé, Rivelino und Zico und spielen schon länger nicht mehr und es steht zu befürchten, dass es im Laufe des Turniers einer Mannschaft gelingt, Neymar sicher zu bewachen.