Libertalia – Von Piraten lernen
Wir brauchen Utopien – Teil 6
von Dirk Jürgensen ...
Vermischen wir das Bild gesetzloser Halunken mit etwas Seefahrerromantik und wildem Abenteuer, stellen wir der brutalen Truppe einen herzlosen, von Grund auf bösen oder einen unfreiwillig in Ungnade des Königs geratenen Kapitän voran, ist unsere tradierte Vorstellung von Piraten zwischen Captain Blood, Captain Flint, dem Roten Korsar und Jack Sparrow vollständig. Wir übersehen dabei, dass das Piratentum durchaus auch eine bis in die heutige Zeit wirkende politisch-philosophische Komponente besitzt, die in der sich entwickelnden Globalisierung des 17. und 18. Jahrhunderts zu begründen ist und uns heute alternative Ideen zum aktuellen Demokratieverständnis im so dominanten Kapitalismus aufzeigen kann. Ein im Januar 2015 erschienenes Buch bietet uns eine wichtige Ergänzung zu unserem bisherigen Piratenbild:
Es handelt von der Geschichte des auf Madagaskar gegründeten Seeräuberstaates „Libertalia“, es beschreibt die Legende von einer wohl tatsächlich gelebten Utopie, die früh Vorbild für Basisdemokratie, einen freiheitlichen – also libertären – Kommunismus werden sollte und einige Parallelen mit den spanischen Anarchisten der Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts aufweist. Sie dürfte lange vor der französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eine enorme Brisanz besessen haben, da in einem Gemisch aus Tatsachenberichten, journalistischem Material, Fiktion und politischer Idee sogar Vorgriffe auf die Aufklärung gewagt wurden und der Text die Bewunderung der vorgetragenen Ideen mit einigen eher alibihaft daherkommenden Bemerkungen zu überspielen versucht.
1728 erschien unter dem Namen Charles Johnson der bis heute meist Daniel Defoe zugeschriebene zweite Band der „Allgemeinen Geschichte der Piraten“, der ein Bericht über die Piratenrepublik und ihre Gründer enthalten ist. Dass die Urheberschaft weiterhin umstritten ist, dazu ein niederländischer Buchdrucker und eine anonyme Autorschaft ins Spiel gekommen ist, soll hier nur am Rande erwähnt werden. Viel interessanter ist, dass der Text fast dreihundert Jahre warten musste, um endlich unter der Herausgabe von Helge Meves von David Meienreis erstmalig in die deutsche Sprache übersetzt zu erscheinen. Dass man sich beim Berliner Verlag Matthes & Seitz für Daniel Defoe als auf dem Cover zu vermerkenden Verfasser entschieden hat, sei der Einfachheit oder auch der besseren Vermarktung geschuldet. Dass man den schmucken Band um eine von Arne Braun übersetzte „Beschreibung der Regierung, Gewohnheiten und Lebensart der Seeräuber auf Madagaskar“ von Jacob de Bucqouy und um eine Vielzahl ergänzender Beiträge vervollständigte, macht ihn umso wertvoller.
„Libertalia“ erzählt vom aus wohlhabenen Hause stammenden Misson, der eher zufällig an die Führung eines Schiffs gerät und seinem Freund, dem von der geld- und karrieresüchtigen Kirche enttäuschten ehemaligen Priester Caraccioli, der ihm die theoretischen Grundlagen für seinen revolutionären Führungsstil schafft und die Mannschaft in aufklärerischem Geist religionskritisch und antimonarchistisch belehrt.
Caracciolis Rat folgend lässt sich Misson von der Mannschaft zum Kapitän wählen und ebenso demokratisch über den weiteren Kurs abstimmen. Bei der Diskussion um die zu hissende Flagge schlägt der Bootsmann eine schwarze vor, doch Caraccioli entgegnet:
Sie seien keine Piraten, sondern Männer, entschlossen, die Freiheit zu behaupten, die Gott und die Natur ihnen geschenkt hätten; sie würden sich keinen anderen Regeln unterwerfen als denen, die für das Wohlergehen aller nötig seien.
Weiterhin führt er aus, dass Gehorsam gegenüber Vorgesetzten notwendig sei,
wenn diese die Pflichten ihres Amtes kennten und danach handelten; wenn diese beflissene Wächter der Rechte und Freiheiten der Menschen seien; wenn sie dafür sorgten, dass Gerechtigkeit walte; wenn sie sich gegen die Reichen und Mächtigen stemmten, sobald diese versuchten, die Schwächeren zu unterdrücken.
Nach weiteren Ausführungen kommt er zum Schluss, dass ihre Sache
mutig, gerecht, unschuldig und ehrenhaft und die Sache der Freiheit sei und plädiert für eine weiße Flagge mit der Göttin der Freiheit, Libertas, darauf […]
Das auf dem Schiff vorhandene Geld wird in einer Schatztruhe verwahrt und von Misson zum Gemeineigentum erklärt. Er mahnt, dass
wenn die Gleichheit untergehe, folgten Elend, Verwirrung und gegenseitiges Misstrauen wie die Ebbe der Flut.
Auch ruft er auf,
Gefangenen eine humane zu großzügige Behandlung zuteilwerden zu lassen,
obwohl ihnen selbst vermutlich nicht so ergehen würde.
Auf nun folgenden Kreuzfahrten wird reichlich Beute gemacht und zahlreiche Sklaven können befreit werden, die sich in einem recht modernen Sinne meist in die eigene Schiffsbesatzung integrieren lassen, denn sie werden eingekleidet und auf die Messen der Mannschaft aufgeteilt, um unter anderem schneller die Sprache zu erlernen und sie zu überzeugten Verteidigern der Freiheit zu machen. Hier zeigt sich der wirklich zeitgemäße humanistischer Aspekt der Geschichte, der uns in Zeiten einer bis zum Hass zunehmenden Angst vor einer gesellschaftlichen Überfremdung zu denken geben müsste, schließlich ist die lebensnotwendige Interaktion auf einem Schiff der damaligen Zeit ein gutes Laborumfeld zur Erprobung des Funktionierens einer Gesellschaft.
Nach einigen weiteren Abenteuern wird irgendwo auf Madagaskar die freie Kolonie Libertalia – die Bewohner bezeichnen sich als Liberti – gegründet und der recht bekannte Piratenkapitän Thomas Tew schließt sich an. Tew erhält den Auftrag zur Eroberung von Sklavenschiffen, um durch deren Befreiung die Kolonie auszubauen, was überaus erfolgreich gelingt. Erbeutetes Geld wird
dem kollektiven Schatz zugeführt,
da in einer Gesellschaft ohne Eigentumsschranken
Geld keinen Nutzen
hat.
Nachdem es in der Kolonie zu Streitigkeiten zwischen Missons und Tews Mannschaften gekommen ist, fordert Caraccioli die friedliche Beilegung und regt für zukünftige Fälle der Allgemeinheit dienende Gesetze und eine Regierung an. So wird eine demokratische Staatsform beschlossen, in der ein für drei Jahre gewählter Conservator als höchste Gewalt eingesetzt wird. Danach wird innerhalb von zehn Tagen die Verteilung eines gerechten Anteils von Privateigentum, wie auch ein allgemeines Gesetzbuch beschlossen, gedruckt und verteilt.
Leider endet kurz nach der Konstitution Libertalias aufgrund einiger dramatischer Schicksalsschläge und eines Angriffs auf die Kolonie – keinesfalls aufgrund interner gesellschaftlicher Probleme – die Utopie der ersten libertären Republik. Doch hält uns das hier besprochene Buch noch einige sehr aufschlussreiche Piratensatzungen bereit, die durchaus nachweisen können, dass die auf Gerechtigkeit basierenden Ideen der Liberti höchstwahrscheinlich unbewusst in ähnlicher Form auch von ganz anderen Piraten geteilt wurden. Neben allgemeinen Verhaltensregeln werden in diesen Satzungen die Verteilungsschlüssel für den Umgang mit erbeuteten Gütern und sogar die soziale Absicherung bei Verwundung festgelegt.
Nicht nur einmal erwähnt darf die „nähere Beschreibung der Regierung, Gewohnheiten und Lebensart der Seeräuber“ des Niederländers Jacob de Bucquoy bleiben, der aufgrund seiner Gefangenschaft in der Hand von Piraten interessante Hinweise auf die erstaunlich unabhängige und vernunftorientierte piratische Gerichtsbarkeit und eine Art Muster-Piratensatzung vorlegt. Danach – vermutlich angesichts der multikulturellen Zusammensetzung der Mannschaften – ist es unter Androhung von Strafe beispielsweise untersagt, über die Religion zu streiten. Ein Ansatz, der uns heute sehr gut gefallen sollte.
„Libertalia – Die utopische Piratenrepublik“ ist ein überraschend aktuelles Werk, das zwar sehr spät, aber irgendwie genau zur richtigen Zeit in deutscher Sprache erschienen ist. An Tagen, an denen Pegida und deren Derivate jenseits von Dresden einen bedenklichen Konservativismus mit dem Vehikel einer hervorgelockten latenten Fremdenangst propagieren und wirkliche Ideen eines gesellschaftlichen Fortschritts in Form von größerer Gerechtigkeit als „Gutmenschentum“ abtun. Wer hätte je gedacht, dass man Piraten in dieser seltsamen Wortverdrehung als „Gutmenschen“ bezeichnen könnte?
Die Idee eines libertären Kommunismus, der nichts mit dem bekannten totalitären Kommunismus gemein hat, die Hinweise darauf, dass multikulturelle Gesellschaften doch funktionieren, sogar von ihrer Vielfalt profitieren, das Integration auch bedeutet, den zu Integrierenden an den eigenen Tisch einzuladen, dass unsere auf Zins aufgebaute Geldwirtschaft und die ungerechte Verteilung von Reichtum auf Kosten einer armen Mehrheit mehr als einer Reform bedürfen, findet in dieser früh gelebten Utopie von Libertalia Unterstützung und ist ein wichtiger Kontrapunkt in einer aktuell so abgelenkten Diskussion. Ja, wir können von 300 Jahre alten Piraten lernen, wie wichtig Utopien sind.
Ganz nebenbei, dieser wichtige recht unpolitische Punkt sei nicht vergessen, sollte der mit schöner Goldprägung ausgestatte „Libertalia“-Band samt seines reichen Schatzes an ergänzender Information in keinem Bücherregal mit einer abenteuerlich ausgerichteten Sammlung von Piratengeschichten fehlen.
Daniel Defoe: Libertalia – Die utopische Piratenrepublik
Im Verlag Matthes & Seitz, Berlin
Herausgegeben von Helge Meves, übersetzt von David Meienreis und Arne Braun
ISBN 978-3957570000 – 22,90 € (D) – Fragen Sie Ihren lokalen Buchhändler!
Surfziele zum Thema:
Ein Interview von Tobias Lehmkuhl mit Helge Meves beim SWR2 am 5.1.2015














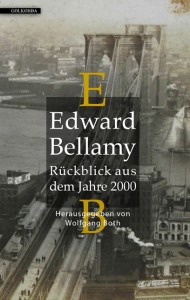






 Düsseldorf. Reich und schön.
Düsseldorf. Reich und schön.