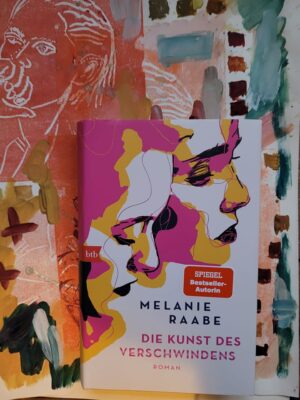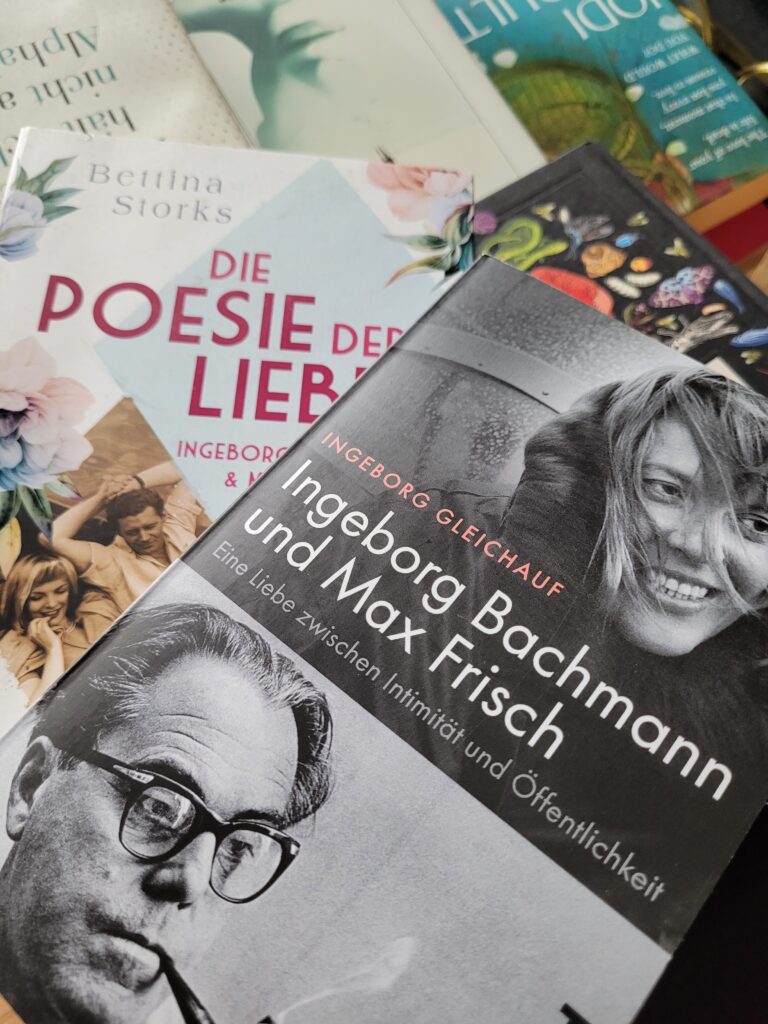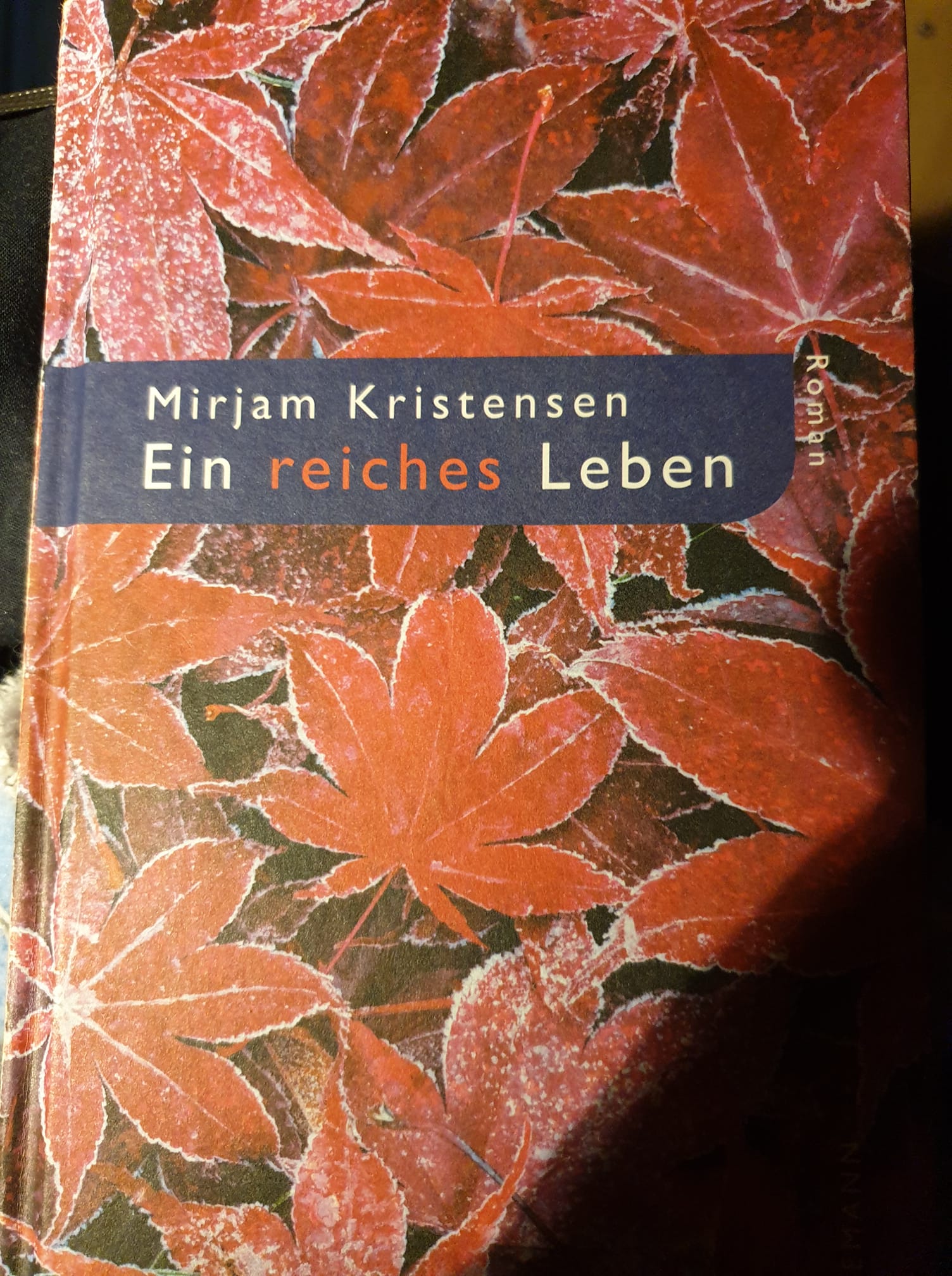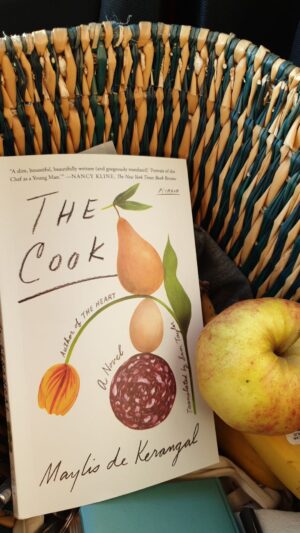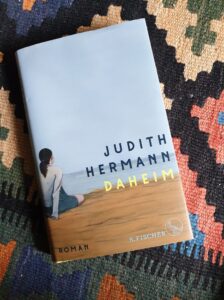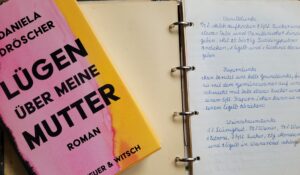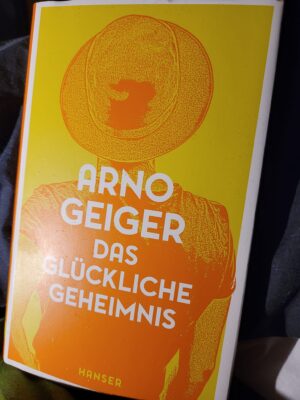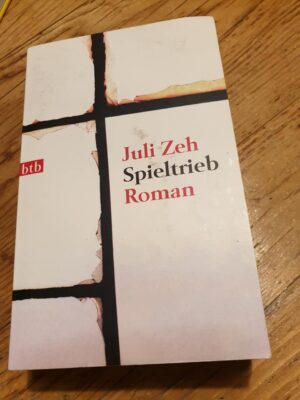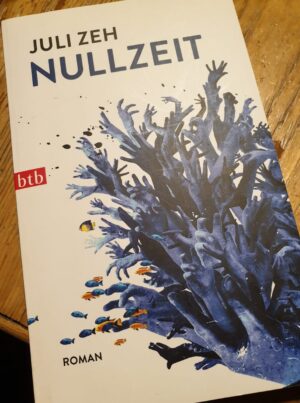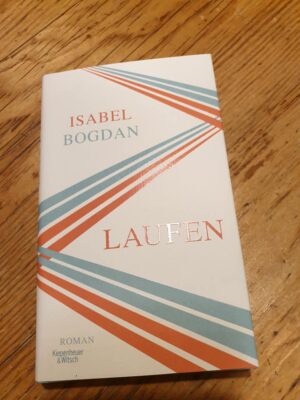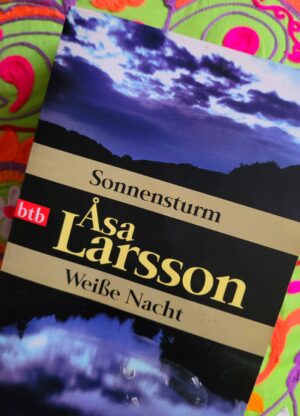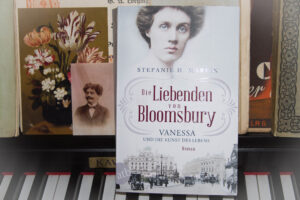Können Zeitreisen helfen? – Tausend und ein Morgen von Ilija Trojanow
Wir brauchen Utopien – Teil 9
von Dirk Jürgensen …
Wir, die Menschen, brauchen Utopien, um uns das Ziel einer besseren Zeit setzen zu können. Als ich diese kleine Reihe unterbrach, war Angela Merkel noch Kanzlerin, die Pandemie stand uns noch bevor und die Kriege dieser Welt fanden noch etwas weiter von Mitteleuropa entfernt statt. Die Warnungen vor dem Klimawandel wurden noch nicht durch Ansätze von Entschiedenheit angegangen. Nun haben wir eine Regierung, die zur Zeit ihrer Anfänge durchaus utopische, also positive, Entwicklungen möglich erscheinen ließ. Die wählenden Menschen schienen sich entschieden zu haben, einen Wandel zu ermöglichen. Skeptisch machte mich schon damals die Beteiligung der FDP an dieser Regierung, die für Utopien nicht empfänglich sah. Inzwischen fühle ich mich bestätigt.
Eine so lange Vorrede, um endlich auf ein Buch zu kommen, das noch einigermaßen aktuell den Buchmarkt bereichert. Es geht um „Tausend und ein Morgen“ von Ilija Trojanow.
Endlich, sagte ich, als ich von seinem neuesten Werk hörte, macht sich ein heutiger Autor an eine Utopie heran und geht nicht den Weg des Einfacheren. Des Einfacheren, weil Spannung und Action in einer Dystopie viel näher liegen, als in einer idealen heilen Welt der Utopie.
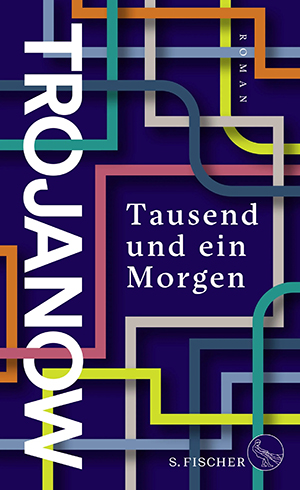
Vielleicht ist das der Grund, warum Trojanow die Form eines Zeitreiseromans wählte und den Ausgangspunkt der Zeitreisen nicht in einer gegenwärtigen Dystopie, sondern in einer zukünftigen utopischen Welt fand. Die Reiseziele der „Chronautin“ (In der Zukunft des Romans ist das heute so arg diskutierte Gendern kein Thema mehr. Der Plural wird feminin gebildet.) liegen in der Vergangenheit. Und entgegen der in der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ immer wieder propagierten Einsicht, dass man ins Raum-Zeit-Kontinuum nicht eingreifen dürfe, ist es die Aufgabe der Reisenden, in die Vergangenheit einzugreifen und sie früher auf einen besseren Weg zu bringen. Begleitet und beraten werden sie dabei von einer künstlichen Intelligenz namens GOG. Stets nach dem Leitspruch, der Geschichte als das beschreibt, was anders hätte verlaufen müssen. Ein humaner Ansatz, der eine Menge Leid auf dem Weg der Menschen zum Besseren soll.
Leider, das darf hier wohl verraten werden, sind die Reisen ins „Damalsdort“, in verschiedene Epochen unserer Vergangenheit und unserer nahen Zukunft nicht von Erfolg gekrönt. Zu komplex, zu unvorhersehbar ist das Verhalten, sind die Interaktionen der einzelnen Menschen und Gesellschaften, denen die Reisenden bei den Piraten des 18. Jahrhunderts, im revolutionären Russland um 1917/1918, bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajewo und im einem religiös aufgeheizten indischen Metropole treffen. Immerhin können die Chronautin ihre Reisen wiederholen, neue Versuche des Eingriffs in die Entwicklungen unternehmen. Vielleicht irgendwann mit Erfolg.
Selbst die beste aller Welten lässt Trojanow nicht ganz ohne Makel, nicht ganz ohne bedenkliche Entwicklungen sein. Die Verselbstständigung der künstlichen Intelligenz, das Streben Einzelner, die der friedlich heilen, beinahe sektenhaften Gesellschaftsordnung, zu stören oder gar zu zerstören, werfen Schatten.
Es bleibt der Literatur noch viel Arbeit, um weitere, noch bessere Utopien zu entwickeln. Schließlich bedeutet Utopie nicht automatisch, dass das entworfene Gesellschaftsmodell das Ende einer Entwicklung sein muss. Das sollte man den Kritiker/innen einer utopischen Idee immer wieder erklären.
Mit Ilija Trojanow hat sich endlich ein Autor seriös an den Aufbau einer Utopie herangewagt und ist nicht dem so leider überwiegenden Drang verfallen, die dystopischen Verhältnisse unserer Gegenwart weiter zu steigern. Dystopien bieten uns zwar Grusel und Action, sie bieten jedoch kein Bild davon, wie das Ziel einer Politik, eines Zusammenlebens aussehen kann, das sich anzustreben lohnt.
Anders als die Chronautin des Romans kennen wir keine Möglichkeit, in die Vergangenheit einzugreifen, es wenigstens zu versuchen. Selbst die Gegenwart scheint uns täglich die falsche Richtung zu weisen. Länder werden von anderen überfallen, religiöse Konflikte werden zum Terror, die Umwelt, das Klima entgegen aller wissenschaftlicher Einsichten nicht positiv beeinflusst, Demokratien befinden sich unterstützt von Populisten im Modus der Selbstzerstörung.
Ich empfehle das Lesen Ilija Trojanows „Tausend und ein Morgen“ und hänge direkt die Hoffnung daran, dass sich noch viel mehr Autorinnen und Autoren aufgefordert fühlen, an ihren Utopien zu arbeiten, um dem Dystopie-Überschuss endlich etwas entgegenzusetzen.
Ilija Trojanow: Tausend und ein Morgen.